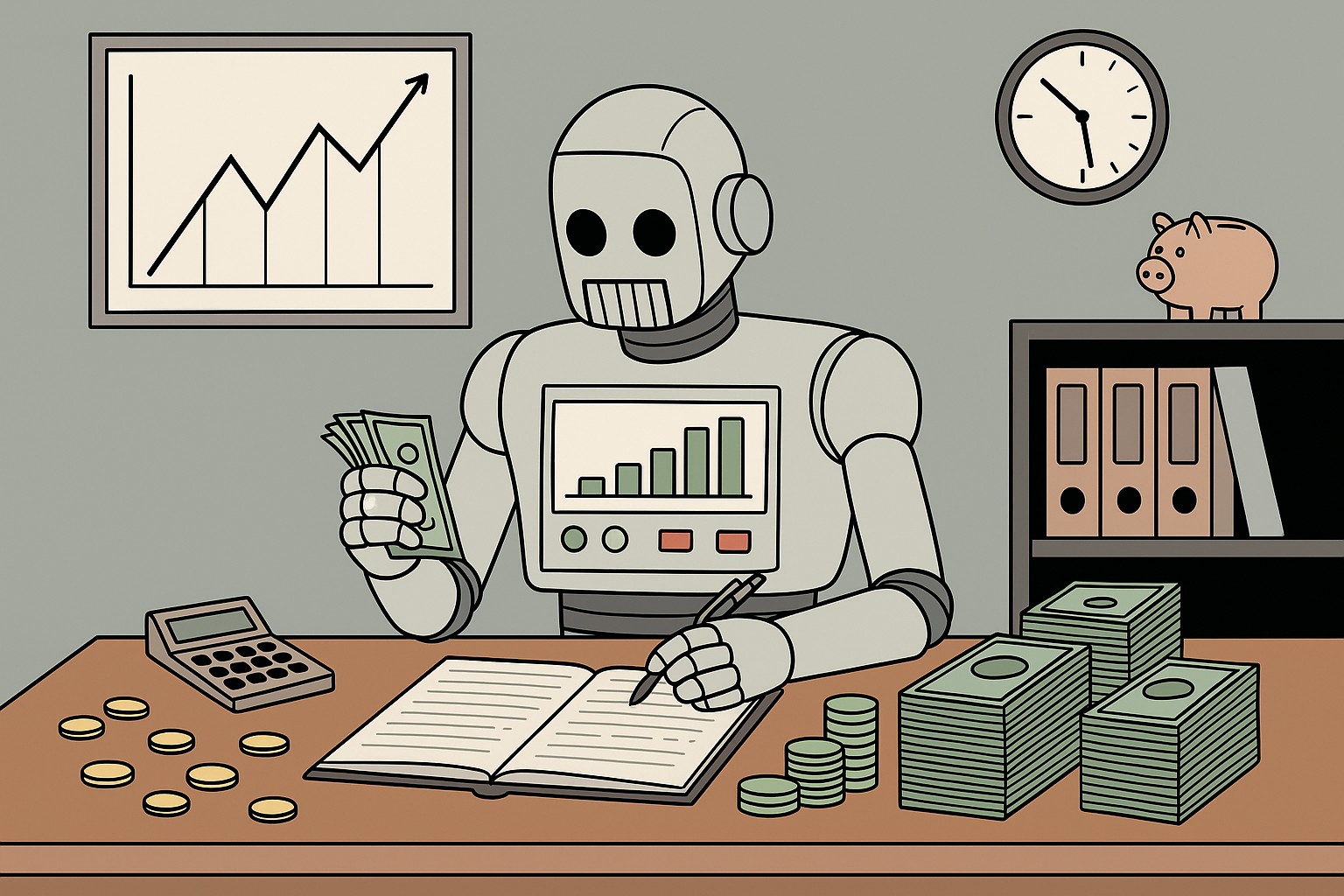BANKINGNEWS: Die Deutsche Sparkassenstiftung trägt das Konzept der Sparkassen hinaus in die Welt. Wie würden Sie den Sparkassengedanken zusammenfassen?
Niclaus Bergmann: Sparkassen sind lokal tätige Finanzinstitute, die eine doppelte Aufgabenstellung haben. Sie müssen auf der einen Seite nachhaltig wirtschaften und somit profitabel sein und auf der anderen Seite haben sie auch einen öffentlichen beziehungsweise sozialen Auftrag. Seit ihrer Gründung vor gut 200 Jahren haben sie die Aufgabe, die lokale Wirtschaftsentwicklung zu fördern und für die finanzielle Inklusion aller Menschen in ihrem Geschäftsgebiet zu sorgen. Und diese Balance zu finden, gelingt den Sparkassen jetzt seit vielen Jahren sehr gut, wobei die kommunale Trägerschaft, die es bei den Sparkassen gibt, hier sehr hilfreich ist, wenn es um die lokale Verankerung geht.
Worin sehen Sie den Auftrag der Sparkassenstiftung?
Bergmann: Ich demonstriere diesen anhand des Beispiels Ghana: In der Hauptstadt Accra findet man jede Menge Banken, die aber nur zehn bis fünfzehn Prozent der Bevölkerung bedienen. Im ländlichen Raum sind diese Banken nicht mehr vertreten. Dort gibt es dann nur noch kleine, lokale Banken, die sich zwar um die Menschen dort kümmern, denen es aber oftmals bei dem sozialen Auftrag, den sie verfolgen, an Professionalität fehlt. Wir unterstützen sie dabei, denn die Strukturierung und Organisation des Bankgeschäfts, wie man neue Produkte entwickelt, Digitalisierung – das sind Themen, mit denen kleine, dezentrale Banken überall in der Welt zu kämpfen haben. Unser Auftrag ist es, unser Wissen an diese Partnerinstitute weiterzugeben. Die große Überschrift wäre hier für uns „Finanzielle Inklusion“.
Wie sind Sie persönlich zur Stiftung gekommen?
Benjamin Wulf: Ich komme selbst aus dem Finanzsektor. Nach meiner Bankkaufmann-Ausbildung und sieben Jahren Arbeit war ich eine Zeit lang im Ausland und bin anschließend zur Unternehmensberatung gewechselt. Doch irgendwann habe ich gemerkt, dass mir auf der einen Seite der Finanzsektor fehlt und auf der anderen Lateinamerika, wo ich viel Zeit verbracht habe. Und ich möchte gerne eine Arbeit machen, die mich mit Sinn erfüllt. In der Beratung geht es dann häufig um Prozessoptimierung und darum, Organisationen umzustrukturieren – das ist alles schön und gut. Aber das sind aus meiner Sicht nicht die wahren Probleme, die wir aktuell haben. Und zufälligerweise passte dann diese Schnittstelle vieler verschiedener Themen genau auf die Stiftung.
Bergmann: Ich arbeite schon seit über 30 Jahren bei der Deutschen Sparkassenstiftung. Nach der Ausbildung bei einer Sparkasse habe ich studiert und dadurch internationale Fragestellungen sowie Entwicklungsökonomie kennengelernt. Danach wollte ich Finanzwesen, Sparkasse, Bank auf der einen Seite sowie die große Welt und Entwicklungsökonomie auf der anderen Seite miteinander verbinden. So kam ich schließlich zu der Stelle und dachte damals, ich mache das mal für ein paar Jahre. Im Endeffekt ist es aber so: Wenn man erst mal dabei ist und sieht, was man bewegen kann, wie viel wir mit unseren Projekten tatsächlich vor Ort verändern und welchen Einfluss wir nehmen können – dann bleibt man auch dabei.
„Wir verfolgen keine politischen oder wirtschaftlichen Eigeninteressen.“
Wie ist ein typisches Projekt organisiert?
Bergmann: Wir haben schon vor 30 Jahren festgestellt, dass das eigentliche Problem nicht fehlendes Geld ist. Wir arbeiten mit Banken vor Ort, Zentralbanken oder Regierungen zusammen – Geld ist da nicht der Engpass, sondern das Knowhow. Das heißt, wir geben unser Wissen und unsere Erfahrungen weiter – wohlgemerkt nie zum Kopieren, das wird nicht funktionieren. Es geht immer darum, dass wir auf unserem Wissen aufbauen, und mit der lokalen Kenntnis unserer Kolleginnen und Kollegen vor Ort ein Konzept entwickeln, das dort funktioniert. Wir haben in allen Ländern, in denen wir tätig sind, immer ein eigenes Büro. In unserem Headoffice in Bonn arbeiten wir mit 40 Personen, und wir haben zusätzlich etwa 300 Mitarbeitende draußen in unseren 50 Projektländern. Im Schnitt sind dann sechs Leute im Land selbst beschäftigt. Diese Büros werden in der Regel von einem internationalen Experten geleitet. Nur etwa ein Viertel der Mitarbeitenden draußen sind also Deutsche oder Europäer, von denen die meisten einen Sparkassen-Hintergrund haben. Denn das Wissen, was wir vermitteln wollen, ist Sparkassen-Knowhow oder deutsches Banken-Knowhow, und dementsprechend brauchen wir einen solchen Anker in unseren Projekten vor Ort. Die Projektbüros arbeiten mit lokalen Partnern zusammen, die fachliche Steuerung der Projekte führen wir von Bonn aus durch.
Lateinamerika zeichnet sich durch sehr diverse Regionen aus, mit unterschiedlichen wirtschaften und sozialen Ausgangsbedingungen. Welche besonderen Bedürfnisse und Herausforderungen sehen Sie in diesen Regionen im Hinblick auf finanzielle Inklusion?
Wulf: Lateinamerika ist sehr heterogen in seinem Entwicklungsstand und seinen Kulturen. Wir haben mit Mexiko und Brasilien zwei Länder, die insgesamt schon relativ weit entwickelt sind. Auf der anderen Seite gibt es mit beispielsweise Bolivien oder Honduras wirklich arme Staaten. Andere Länder wie Venezuela und Nicaragua machen es für uns sehr schwer, dort vor Ort tätig zu sein. Die konkreten Herausforderungen für die finanzielle Inklusion liegen weniger in den Ballungszentren oder im sozioökonomisch starken Teil der Bevölkerung, sondern eben bei den ärmeren Bevölkerungsschichten. Diese Bevölkerungsgruppe kann je nach Land auch mehr als 50 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen.
„Unser Auftrag ist es, unser Wissen an diese Partnerinstitute weiterzugeben. Die große Überschrift wäre hier für uns ‚Finanzielle Inklusion‘.“
Welche Rolle spielt das Thema finanzielle Bildung dabei?
Wulf: Das Thema finanzielle Bildung ist etwas, das wir weltweit sehr stark betreiben. Dabei geht es um Knowhow rund um: Wie funktioniert ein Konto? Wie bekomme ich einen Kredit? Worauf muss ich achten, um diesen Kredit zurückzahlen zu können? Wie kann ich vorsorgen? Auf der einen Seite gilt es zu beachten, ob genügend Angebote von Banken oder Institutionen da sind, und auf der anderen Seite, ob die Notwendigkeiten für eine finanzielle Inklusion vorhanden sind. Zusätzlich ist das Flucht- und Migrationsthema eine große Herausforderung. Gerade aus Venezuela in Richtung Kolumbien, Ecuador, Peru, oder eben nach Mittelamerika in Richtung USA, sind Millionen Menschen auf der Flucht. Auch wenn sie vielleicht kulturell und von der Sprache ähnlich sind, sind sie trotzdem nicht unbedingt willkommen. Außerdem haben viele Länder Lateinamerikas eine sehr patriarchale Kultur und Struktur. Das heißt, Geld ist Männersache, und Frauen haben häufig keinen oder beschränkten Zugang. Denn dort ist es eben so, dass ganze Communitys, ganze Landstriche bislang noch keinen Kontakt zum Finanzsystem hatten, das heißt, es gibt auch kein Knowhow.

Kommt es auch mal zu Komplikationen mit den Regierungen vor Ort?
Bergmann: Wir verfolgen keine politischen oder wirtschaftlichen Eigeninteressen. Im Gegenteil, wir sind altruistisch tätig, und das wissen unsere Partner vor Ort. Das heißt, wir sind überall willkommen und geschätzt. So sind wir nicht wirklich gefährdet, auch nicht korruptionsgefährdet, weil man weiß, wir bringen statt Geld Knowhow zu den Menschen. Ich weiß, dass unsere politischen Stiftungen in einigen Ländern Probleme haben, weil sie die Machtposition der Regierungen vielleicht gefährden, wenn sie mit der Opposition arbeiten. Das ist für uns kein Thema. Wir helfen den Menschen vor Ort und das ist eine wichtige Grundlage dafür, dass wir in vielen, auch sehr schwierigen Ländern tätig sein können. Wirklich kritisch wird es dann, jetzt mal banal gesagt, wenn Bomben fliegen. Wichtig ist, dass wir Büros vor Ort haben, die die aktuellen Entwicklungen einschätzen können. Wir müssen dort auch mit anderen internationalen Organisationen vernetzt sein. Die Deutsche Botschaft kann uns in der Regel Hinweise geben, sodass wir in besonders kritischen Fällen die Möglichkeit haben, unsere Leute rauszubringen. Es hat Situationen gegeben, und das habe ich in den letzten 30 Jahren vielleicht vier, fünf Mal erlebt, wo wir uns zeitweise aus einem Land zurückziehen mussten. Wichtig ist, dass wir uns vor Ort nicht instrumentalisieren lassen, denn damit würden wir Partei werden. Mit einer solchen klaren Kommunikation von Anfang an kann man in der Regel auch unter schwierigen Rahmenbedingungen gut arbeiten.
Mit welchen lokalen Institutionen und Organisationen arbeiten Sie konkret in Lateinamerika zusammen und wie kommen Sie zu diesen Partnerschaften?
Wulf: Man wählt natürlich hier und da Projektländer dementsprechend aus. Ich begleite ein ESG-Projekt – da gibt es Regierungen, die grundsätzlich offen dafür sind. Genauso gibt es aber Regierungen, die das weniger unterstützen. Zum Beispiel wäre es in Brasilien vor ein paar Jahren unter Bolsonaros Präsidentschaft vielleicht sehr schwer geworden, mit so einem Thema im Land Fuß zu fassen. In Lateinamerika haben wir extrem stabile und lange Netzwerkbeziehungen, auf denen man aufbauen kann. Auch wenn wir in einem Land noch gar nicht tätig waren, gelingt es meistens über international tätige Verbände wieder relativ schnell an Kontakte zu kommen. Tatsächlich passiert das auch manchmal durch die Sparkassen-Finanzgruppe. Zum Beispiel haben wir in Brasilien Kontakt zur LBBW oder Deutschen Leasing, da sie Büros in Sao Paulo haben. Wenn wir in einem Land komplett neu starten, führen wir eine sogenannte „Fact Finding Mission“ durch, bei der ein bis zwei Mitarbeitende einige Wochen vor Ort mit wichtigen Stakeholdern sprechen. Das können Ministerien sein, Verbände, einzelne Institutionen, aber auch andere Institutionen der deutschen Zusammenarbeit, etwa die Botschaft, die GIZ, oder die KfW. Es werden die lokalen Herausforderungen und Bedarfe analysiert und anschließend mit den Partnern evaluiert, ob und wie die DSIK eine nachhaltige Weiterentwicklung unterstützen kann.
„Aus meiner Sicht ist der Verlust von Biodiversität, welcher eng mit der globalen Erwärmung verknüpft ist, eigentlich sogar das gravierendere Problem.“
Welche Ihrer Projekte haben Sie besonders begeistert?
Wulf: Für mich ist das Thema Bildung sehr wichtig. Grundsätzlich empfinde ich alle Initiativen, die sich darum kümmern, institutionell eine duale Ausbildung in den Ländern zu implementieren, als nachhaltig große Erfolge. Das hilft auch dabei, das Knowhow im Land selbst eigenständig aufzubauen. Mit Blick in die Zukunft brenne ich sehr für ökologische Nachhaltigkeit. In Deutschland steht die globale Erwärmung medial immer sehr im Fokus. Aus meiner Sicht ist der Verlust von Biodiversität, welcher eng mit der globalen Erwärmung verknüpft ist, eigentlich sogar das gravierendere Problem. Und da haben wir natürlich gerade in Lateinamerika einen riesengroßen Hebel, wenn ich mir die Biodiversität in Ländern wie Ecuador, Brasilien oder Peru anschaue. Wir versuchen dort mit unserer Arbeit Kleinbäuerinnen und Kleinbauern auf dem Land ein gutes Leben zu ermöglichen, ohne dabei der Natur nachhaltig zu schaden. Auf diese Weise einen möglichen Impact zu haben, ist das, was mich antreibt.
Bergmann: Ich bin vor kurzem für eine Woche in der Türkei gewesen. Wir haben dort ein Projekt, wo es um die Integration von über fünf Millionen Geflüchtete geht, die dort leben. Gleichzeitig werden dabei aber auch junge Einheimische als Zielgruppe unterstützt. Das Projekt führen wir seit drei, vier Jahren durch, und wir haben in der Türkei zwei Partnerbanken gewinnen können, das ist einmal eine Mikrofinanzinstitution und zum anderen eine Geschäftsbank. Und die sind bereit, wenn wir die Menschen vorher geschult haben, und bei der formellen Seite der Existenzgründung unterstützt haben, hier kleine Kredite zu vergeben. Mittlerweile sind fast 5000 Kredite für Existenzgründer vergeben worden. Wir haben einige dieser Existenzgründer besucht, und es war wirklich sehr emotional zu sehen, wie einige der Geflüchtete sich in der Türkei eine neue Existenz aufgebaut haben und Netzwerke mit der lokalen Bevölkerung entstanden sind.
Gibt es auch ein negatives Beispiel?
Bergmann: Was mir große Sorgen bereitet: Überall in der entwickelten Welt ist das Geld für Entwicklungszusammenarbeit knapp. Und in den letzten ein, zwei Jahren haben sich die Prioritäten verschoben. Momentan fließt viel Geld – aus guten Gründen – in Richtung Ukraine und Nachbarländer. Da mehr Geld aber einfach nicht zur Verfügung steht, wird es woanders weggenommen, und wir sehen, dass die Entwicklungszusammenarbeit in Afrika im Prinzip von allen Ländern, und multilateralen Einrichtungen dramatisch eingeschränkt wird. Das ist langfristig nicht gut, denn die Probleme in Afrika sind ja nicht verschwunden. Und wenn wir es nicht schaffen, den Menschen tatsächlich in ihren Heimatländern eine Perspektive zu geben, dann werden wir nachher selbst auch ein Riesenproblem bei uns haben.
Sprechen Sie auch gezielt jüngere Menschen an, um sie für eben solche Projekte und letztlich den Job zu motivieren?
Bergmann: Wir betreiben jetzt seit über zehn Jahren ein Nachwuchsförderprogramm für Leute, die in Sparkassen in Deutschland arbeiten. Jedes Jahr haben etwa 20 bis 25 junge Menschen die Möglichkeit, in eines unserer Projekte zu gehen und dort für vier bis acht Wochen mitzuarbeiten. Dort können sie ihr eigenes Knowhow einbringen und lernen auch die Situation in den Ländern kennen. Denn sie sind lange genug vor Ort, dass sie in die Kultur des Landes eintauchen können – und zwar nicht aus der Perspektive eines Urlaubers, sondern aus der unserer Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Das ist quasi ein Triple Win: Unsere Projektpartner vor Ort profitieren von dem, was die jungen Leute mitbringen. Die jungen Leute selbst profitieren davon, weil sie ganz neue Impulse für ihr Leben bekommen. Und der Arbeitgeber profitiert davon, weil das ein spannendes Instrument der Mitarbeiterbindung ist.
Dieses Interview wurde im November 2024 geführt.

Niclaus Bergmann
Niclaus Bergmann ist Managing Director bei der Deutschen Sparkassenstiftung für Internationale Kooperation.

Benjamin Wulf
Benjamin Wulf ist Project Manager Latin America and the Caribbean bei der Deutschen Sparkassenstiftung für internationale Kooperation.